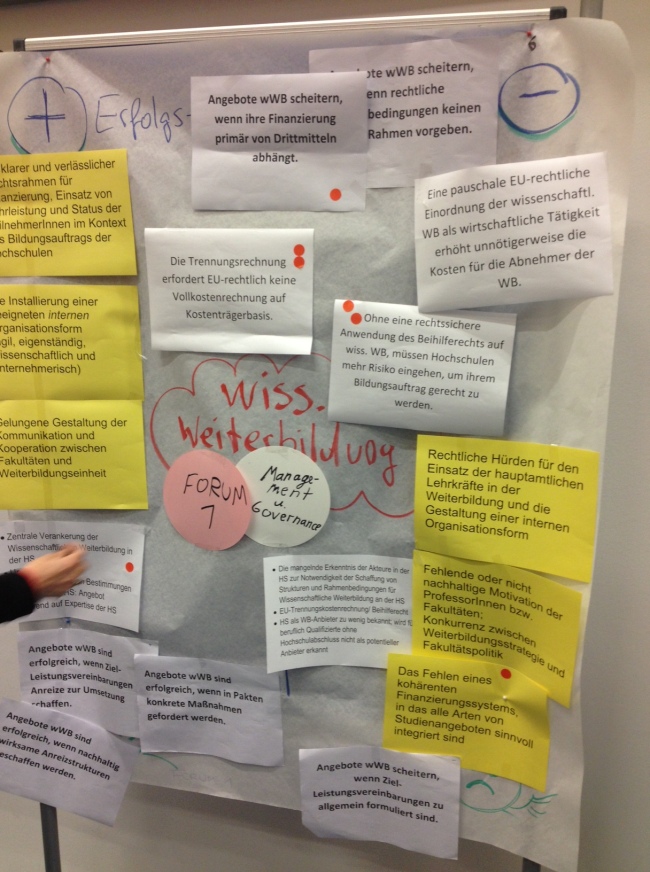Sollen Menschen Hilfe bekommen, die sterben wollen, aber sich nicht selbst töten können? Sollen sie vielleicht sogar einen Anspruch auf aktive Sterbehilfe haben? Kirchen, Prominente wie Franz Müntefering, Ärzteverbände und Parteien sagen Nein. Mich überzeugen die Argumente nicht. Ein Plädoyer für Autonomie und Freiheit am Lebensende.
Gegner aktiver Sterbehilfe führen typischerweise fünf Argumente für ihre Position an.
Argument 1: Menschen könnten sich gegen ihren Willen zum Sterben genötigt fühlen.
Müntefering und andere beschwören das Bild des alten Mütterchens herauf, das seinen Verwandten nicht länger zur Last fallen will und sich deshalb für den Freitod entschließt oder von diesen dazu gedrängt wird. Das Bild ist so eindrücklich, dass es leicht überdeckt, wie wackelig die Hypothese ist. Nötig wäre ein empirischer Beleg dafür, dass es das Mütterchen (und dessen ruchlose Verwandtschaft) überhaupt gibt. Dass die Zahl assistierter Freitode alter Menschen in Ländern wie den Niederlanden mit liberaler Sterbehilfepraxis nicht steigt, spricht dagegen.
Hinzu kommt, dass Autonomie und Freiheit des Einzelnen zu den wichtigsten Grundwerten unserer Gesellschaft gehören. Ein ganzes Erwachsenenleben lang treffen wir eigenverantwortlich Entscheidungen. Viele sind gut, andere dumm, manche für Dritte nicht nachvollziehbar. Wieso das am Lebensende und im Angesicht der letzten Fragen plötzlich anders sein soll, will mir nicht in den Kopf.
Wie wäre es, aktive Sterbehilfe zu gestatten, aber eine Beratungspflicht einzubauen? Das könnte die Sorge der Gegner lindern, dass sich jemand unter Zwang das Leben nehmen will. Die Regelung zur Abtreibung mit Fristenlösung und Schwangerenkonfliktberatung könnte als Vorbild dienen.
Argument 2: Die Palliativmedizin kann das Leid am Lebensende so weit lindern, dass Sterbehilfe nicht nötig ist.
Mag sein. Doch wäre es eine Bevormundung, die mit den Prinzipien unserer freiheitlichen Gesellschaft unvereinbar ist, Menschen das Recht auf den eigenen Tod zu verweigern. Der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf (1965 – 2013) beschreibt in „Arbeit und Struktur“ sehr eindrücklich, wie befreiend für ihn das Wissen war, seinem Leben selbstbestimmt ein Ende setzen zu können.
Argument 3: Was, wenn der Todeswunsch einer Krankheit entspringt, die die Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt?
Kranke müssen behandelt werden. Ansonsten gilt: Gesunde haben Aspruch auf Respekt vor ihren Entscheidungen.
Argument 4: Gott hat die Selbsttötung verboten. Also ist Sterbehilfe Sünde.
Deutschland ist im Prinzip ein laizistisches Land. Kirche und Staat sind getrennt (auch wenn das nicht überall sauber durchgehalten wird). Glaubensgemeinschaften dürfen Regeln für die eigenen Mitglieder erlassen. Sie haben aber keinen Anspruch darauf, andere zu bevormunden.
Argument 5: Es ist ein Unding, am Sterben anderer Menschen Geld zu verdienen.
Friedhofsgärtner, Steinmetze und Bestatter verdienen ihr Geld mit dem Tod. Das findet auch keiner anrüchig. Hinzu kommt: Ein Sterbehilfeverein gefährdet nicht die Jugend und beeinträchtigt Dritte nicht in ihrer Entfaltung. Es gibt aus meiner Sicht somit keine Gründe, die Gewerbefreiheit einzuschränken.
Argument 6: Auf A wie aktive Sterbehilfe folgt bald E wie Euthanasie.
Das ist kein Argument, sondern der Popanz eines Arguments. Das Argument rührt zwei Dinge zusammen, zwischen denen ein tiefer Graben liegt. Auf der einen Seite geht es um die Hilfe bei der Selbsttötung eines erwachsenen Menschen mit wachem Verstand, auf der anderen Seite um die Frage, ob der Staat oder irgendeine andere Instanz darüber bestimmen darf, Menschen zu töten, die sich selbst nicht artikulieren können. Zu behaupten, die meisten Menschen könnten nicht den Unterschied erkennen, beleidigt den Verstand.
Man kann Ersteres entschieden bejahen, und Letzteres ebenso entschieden ablehnen. So wie ich es tue.